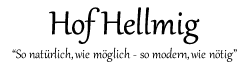Muttergebundene Kälberaufzucht
Allgemeines
Muttergebundene Kälberaufzucht ist ein Begriff, der sich in der Milchwirtschaft etabliert hat. Im Gegensatz zur Mutterkuhhaltung, wo Kuh und Kalb ausschließlich zusammenleben und nur zur Fleischproduktion dienen, wird bei der muttergebundenen – oder auf manchen Betrieben auch ammengebundenen Aufzucht – die Kuh trotzdem gemolken und dient der Milchgewinnung.

Um Milch zu produzieren brauchen wir Kühe.
Seit Jahrtausenden liefern sie den Menschen nicht nur Fleisch als Lebensmittel, sondern auch ihre wertvolle Milch. Das Schöne daran ist, dass sie für dieses Lebensmittel nicht erst sterben müssen, sondern bei der richtigen Fütterung und Haltung bis an ihr Lebensende einen Nutzen für uns Menschen haben und damit eine Daseinsberechtigung. Leider hat die Industrialisierung und der Wachstumswahnsinn dazu geführt, dass der Mensch den Bezug zur Natürlichkeit verloren hat und der Landwirt durch Preisverfall und Kostendruck, den er nicht an den nächsten weitergeben kann, dazu gezwungen wird, unnatürliche Zustände einzuführen und irgendwann zur Normalität zu erklären.
Im Grunde ist die moderne Kuh von heute ein Hochleistungssportler und so wird sie auch behandelt. In einem modernen Stall, der auf Leistung setzt, fehlt es den Kühen an nichts. Sie werden 24 Stunden am Tag umsorgt, bekommen bis zum letzten Gramm durchkalkulierte Mahlzeiten, ihre Gesundheit wird mit Argusaugen überwacht, es gib Wellness und den besten Schlafkomfort, den sich eine Kuh nur wünschen kann. Sie lebt in einem goldenen Schloss, damit sie ihre ganze Energie in ihre Leistung stecken kann. Sich daneben noch um Kinder kümmern zu müssen, wäre eine Doppelbelastung, die unweigerlich zu Leistungsverlust im Job führen würde. Jede Berufsfrau mit Familie weiß, wovon ich spreche. Seine Freizeit draußen in der Natur zu verbringen ist nicht nur gefährlich, es verbrennt Energie, die dann für den Job nicht mehr zur Verfügung steht…
Das was dabei verloren geht, ist die Natürlichkeit. Und unser Anliegen ist genau dagegen anzusteuern: Zurück zur Natur, auch im Leben unserer Hochleistungskühe. Natürlich ist dann die Spitzenleistung nicht mehr möglich. Aber es bringt Lebensfreude zurück. Und Lebensfreude schafft Energie und Energie macht aktiv und Aktivität hält fit und gesund! Und eine Kuh, die lange lebt, ist wiederum wirtschaftlich.

Um Milch zu geben müssen Kühe erst ein Kalb bekommen.
Das ist von der Natur so vorgegeben. Auch der Rhythmus einer Laktation, also die Zeitspanne, in der eine Kuh ihr Kalb ohne den Eingriff des Menschen säugen würde, ist von der Natur bestimmt und trotz regelmäßigem Melken versiegt die Milch nach neun bis zwölf Monaten wieder. Manch eine schafft es länger, aber im Durchschnitt ist es diese natürliche Zeitspanne, die uns erlaubt Milch von der Kuh zu bekommen, ehe sie wieder ein Kalb zur Welt bringen muss, um neu ihre volle Leistung zu entfalten. Das führt dazu, dass Milchkühe jedes Jahr ein Kalb bekommen. Um den Verlust durch das Saufen der Kälber gering zu halten und aus arbeitstechnischen, aber vor allem wirtschaftlichen Gründen, ist man dazu übergegangen, die Kälber direkt nach der Geburt von der Mutter zu trennen und gesondert aufzuziehen. Die direkte Trennung hat den Vorteil, dass Kuh und Kalb in den meisten Fällen noch keine Bindung aufgebaut haben und unter dieser Trennung nicht offensichtlich leiden. Das ist in jedem Fall besser, als das Kalb einige Tage bei der Mutter zu lassen (beispielsweise in den ersten fünf Tagen, in denen die Milch der Kuh sowieso nicht verkauft werden darf) und es erst dann zu trennen. Dann ist der Schmerz unerträglich. Nichts desto trotz ist es kein natürlicher Vorgang. Und noch schlimmer, als die Trennung an sich, ist für uns das Verfrachten in Einzeliglus, wo jedes Kalb für sich die ersten zwei Wochen verbringt. Hygienisch und für die Kontrolle der Milchmenge, die es trinkt, hat es sicherlich seine Vorteile, aber es wird dem Herden- und Sozialtier Rind in seinem natürlichen Verhalten nicht gerecht.
Definition

Es gibt ca 80 Betriebe in Deutschlang, die ihre Kälber an der Kuh großziehen.
Dabei gibt es aber für die Bezeichnung muttergebundene – oder alternativ ammengebundene – Aufzucht keine einheitliche Definition. Die Auslegung und Umsetzung ist nicht gesetzlich oder rechtlich vorgegeben oder geschützt.
Gemeinsam haben sie, dass die Kälber, die auf dem Betrieb großgezogen werden, an einer Kuh gesäugt werden und nicht im Einzeliglu per Nuckeleimer. Wie dies dann umgesetzt wird und wie viele der auf einem Betrieb geborenen Kälber tatsächlich in den Genuss kommen, kann von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich sein.
Die Herausforderung ist sicherlich bei allen die Gradwanderung zwischen Tierwohl und Wirtschaftlichkeit, zwischen Gesundheit und Arbeitsaufwand. Und ganz sicher spielt auch die zugrundeliegende Motivation eine Rolle: Idealismus, Tierliebe, den Anforderungen der Gesellschaft gerecht werden, der finanzielle Ansporn (wenn man für diese Milch eine höhere Wertschöpfung erzielen kann) oder reiner Pragmatismus. Ich kann nur jedem raten: schaut euch auch diese Betriebe immer ganz genau an! Muttergebundene Aufzucht ist nicht gleich Muttergebundene Aufzucht. Der Begriff an sich sagt noch nicht wirklich viel darüber aus, was tatsächlich dahintersteckt.
Unabhängig von der Anzahl der Kälber, die auf einem Betrieb tatsächlich verbleiben dürfen (alle, nur die weiblichen oder nur die geeignete Nachzucht für die Herde, oder nach vier Wochen sind auf einmal alle weg?) gibt es auch in der Durchführung sehr unterschiedliche Varianten.
Es gibt Betriebe, die die Kälber komplett über die drei Monate oder auch länger im Herdenverband belassen und dann irgendwann ad hoc absetzen. Der Trennungsschmerz ist dann eine ernst zu nehmende Herausforderung.
Es gibt zeitlich begrenzte Phasen vor oder nach dem Melken, in denen Kuh und Kalb zusammenkommen und dann wieder getrennt werden. Es gibt Ammenkuhhaltung, wo nicht die eigene Mutter, sondern eine Amme mehrere Kälber großzieht.
Und schlussendlich gibt es Kombinationen aus all diesen Verfahren.

Unsere Definition
Wichtig ist für uns die Frage: geht es vorrangig um das Kalb oder geht es dabei um die Kuh?
Unsere Motivation ist es, unseren Milchkühen für ihren Job etwas zurückzugeben und nicht nur den Kälbern zu ermöglichen an einem Euter zu saufen. Wir machen es nicht, um dem Verbraucher Tierwohl vorzuspielen oder weil uns jemand dafür einen besseren Milchpreis bezahlt.
Deshalb bedeutet für uns muttergebundene Kälberaufzucht, dass alle unsere Kühe ihr eigenes Kalb großziehen dürfen; und zwar über die gesamte Tränkephase. Keine Rotation nach vier Wochen, keine Kompromisse mit Ammen (außer eine Kuh nimmt ihr Kalb nicht an) und soweit wir es bewerkstelligen können und Unterstützung durch die Patenschaften bekommen, auch für jede Kuh (egal ob sie ein Top-Kalb zur Welt bringt oder eher ein weniger vielversprechendes, ein Frühchen oder gar krankes Kalb, die sich wirtschaftlich nicht wirklich rechnen).
Dafür haben wir ein System entwickelt, mit dem wir mittlerweile recht zufrieden sind. Oder besser gesagt, es hat sich über den Zeitraum von etwa einem Jahr, durch die auftauchenden Probleme und die dazu gefundenen Lösungen etabliert.
Die Herausforderungen

Es gibt verschiedene Herausforderungen bei der muttergebundenen Aufzucht, für die jeder Betrieb seine eigenen Lösungen finden muss. Deshalb wäre eine gestzliche Regelung für diese Aufzucht eher von Nachteil, da jeder Betrieb andere Voraussetzungen mitbringt und gesetzliche Vorgaben oft von Theoretikern und weniger von Praktikern aufgestellt werden.
Welche Herausforderungen gilt es zu meistern?
Zum einen ist da natürlich der eigene Anspruch an das System. Wie unter „Definition“ beschrieben, fällt darunter die Frage: wofür und für wen betreiben wir den Aufwand und wieviel Aufwand ist es uns wert?
Da für uns klar war, dass wir es jeder Kuh ermöglichen wollen -und zwar über den gesamten Zeitraum bis zum endgültigen Entwöhnen des Kalbes von der Milch- mussten wir folgende Herausforderungen meistern:
1. Stress von Kuh und Kalb
2. Tiergesundheit von Kuh und Kalb
3. Arbeitsaufwand
4. Melken
5. Absetzten
6. Wirtschaftlichkeit, d. h. genug Milch für den Verkauf
Zu 1: Stress

Natürlich hat eine Kuh einen gewissen Stresspegel, wenn sie für ihr Kalb selber verantwortlich ist. Das Wissen, dass es ihrem Kalb gut geht, dass es sicher aufgehoben ist und ausreichend Nahrung bekommt, ist für die Mutter von äußerster Wichtigkeit, um sich entspannen zu können. Man mag es nicht glauben, aber jede Kuh weiß ganz genau, ob ihr Kalb satt ist, ob es gesund ist und ob es sicher ist. Ist dies nicht der Fall, wird sie nervös, verweigert das Verlassen des Stalls zum Melken, oder gibt im Melkstand ihre Milch nicht her. Sie kommt im Stall nicht zur Ruhe und frisst und widerkäut dann nicht mehr genug, was sich sehr schnell negativ auf ihre Milchproduktion auswirkt und einen negativen Teufelskreis in Gang setzt.
Zu 2: Gesundheit

Tiergesundheit ist ein wichtiges Thema. Es ist leider keine Selbstverständlichkeit, dass jedes Kalb innerhalb weniger Stunden seine erste und sehr wichtige Mahlzeit eingenommen hat (Kolostrum/ Biestmilch). Da ist genaue Beobachtung gefragt und zur Not eine Versorgung mit dem Nuckeleimer in den ersten Tagen notwendig, bis das Kalb begriffen hat, dass das Euter der Mutter die immer erreichbare Milchbar enthält.
Leben die Kälber von Anfang an in einer größeren Gruppe, ist der Keim- und Krankheitsdruck so wie die Ansteckungsgefahr größer, als in einem abgeschotteten Einzeliglu. Gleichzeitig haben sie aber durch diese Haltung ein deutlich besseres Immunsystem. Sie können im besten Fall mehrfach am Tag kleine Mengen der perfekt auf sie abgestimmten Muttermilch in der richtigen Temperatur aufnehmen. Außerdem sind manche Mütter äußerst penibel, wenn es darum geht, ihr Kalb sauber zu halten. Auch das regelmäßige Misten ist wichtig.
Die Gesundheit der Kühe spielt auch eine Rolle, denn sobald negativer Stress aufkommt, leidet die Eutergesundheit. Sei es, weil die Kälber nicht genug Milch abbekommen und dann ziemlich brutal mit den Zitzen umgehen, oder tatsächlich eine Euterentzündung durch falsches Melken entsteht.
Zu 3: Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand darf die Kapazitäten der zuständigen Personen nicht überschreiten. Bei uns ist das meistens eine Person alleine, die die Stallarbeit schaffen muss. Im Grunde ist der Aufwand aber, wenn man es vernünftig organisiert hat, nicht größer als bei der konventionellen Iglu-Haltung. Denn die Zeit, die man für Beobachtung, Kälber zu den Kühen lassen und wieder trennen investiert, spart man mit dem Verzicht auf Milch vorbereiten, aufheizen, in Nuckeleimer verteilen und hinterher wieder spülen, leicht ein. Der Beobachtung der Entwicklung der Kälber muss aber ein weit größerer Wert beigemessen werden, da man keinen eindeutigen Parameter für die tatsächlich aufgenommene Milch eines Kalbes pro Tag hat. Da ergibt dann nur der Gesamtzustand des Kalbes Aufschluss und muss konsequent im Auge behalten werden.
Zu 4: Melken

Das Melken ist sicher eine der größten Herausforderungen, denn wie schon unter dem Punkt Stress beschrieben, wollen die Kühe ihr Kalb satt wissen. Das heißt, sie entwickeln teilweise wirklich erstaunliche Strategien, ihre Milch zurück zu halten, und geben sie problemlos her, wenn es sich um Überschuss handelt. Gleichzeitig ist es absolut schädlich ein leeres Euter zu melken, selbst wenn man meint noch ein paar Tropfen herausholen zu können. Euterentzündungen sind dann vorprogrammiert. Als Melker ist man sehr stark gefordert jeden Tag aufs Neue ganz genau die Euter zu kontrollieren und richtig einzuschätzen, um zu verhindern Milchmenge zu verlieren und um Blindmelken zu vermeiden.
Zu 5: Absetzen

Die Herausforderung schlecht hin. Leider. Denn auch wenn viele der Meinung sind, dass die direkte Trennung nach der Geburt für die Kuh das Schlimmste sei in Bezug auf den Trennungsschmerz: nein ist es nicht. Es wird eigentlich immer schlimmer, je länger sie zusammen sein dürfen. Und der übliche Zeitpunkt des Absetzens mit 3 Monaten ist eigentlich einer der ungünstigsten Zeitpunkte überhaupt, da das Kalb in diesem Alter gerade das Maximum an Milchmenge aufnimmt, wenn es freien Zugang hat. Auch ist der Sozialkontakt zwar in diesem Alter mittlerweile nicht mehr ausschließlich auf die Mutter fixiert, dennoch ist die Bindung extrem eng auch über das Bedürfnis der Ernährung hinaus.
Zu 6: Wirtschaftlichkeit
Dagegen steht leider der wirtschaftliche Faktor, den ein Betrieb, der vom Milchverkauf abhängig ist, nicht ignorieren kann. Das heißt, es muss noch so viel Milch zum Verkauf übrigbleiben, dass sich das Konzept finanziell trägt. Bei den gängigen Marktpreisen ein fast nicht zu bewerkstelligendes Unterfangen, weshalb die meisten Betriebe, die diese Aufzucht praktizieren, irgendwann in eine eigene Vermarktung einsteigen oder aufgeben.
Unser System
Im Mai 2016 haben wir mit der muttergebundenen Aufzucht begonnen. Mittlerweile haben wir bereits zwei Jahrgänge aus dieser Aufzucht, die bereits selbst wieder Kälber bekommen haben.
Um allen Herausforderungen gerecht zu werden und den bestmöglichen Kompromiss zu finden, hat sich bei uns ein schrittweises System entwickelt, das mit einer gemeinsamen Zeit von 24 Stunden in den ersten Wochen beginnt und mit der heiligen halben Stunde morgens nach dem Melken bis zu einem Alter von sechs bis hin zu neun Monaten (je nach Entwicklung und Herdenverträglichkeit) vor dem endgültigen Entwöhnen endet. Update (2023) leider musste wir die heilige halbe Stunde wieder drangeben, da es zu einem wirtschaftlichen Desaster geführt hat. Um etwas mehr Milch für den Verkauf übrig zu haben, um den Betrieb am Laufen halten zu können, mussten wir das Absetzten nach drei bis vier Monaten wieder einführen.
Im Folgenden stellen wir das System in seinen einzelnen Abschnitten ausführlich vor.
Die Geburt

Bevor eine Kuh ihr nächstes Kalb bekommt, hat sie ca acht Wochen Mutterschutzurlaub. In dieser Zeit wird sie nicht mehr gemolken und kann sich ganz und gar auf sich und das werdende Kalb in ihrem Bauch konzentrieren. In der Landwirtschaft werden diese Kühe Trockensteher genannt und bei uns verbringen sie diese Zeit im Sommer auf unserer Teichweide. Sie liegt direkt am Hof und bietet alle Voraussetzungen, die man sich von einem Vorbereitungs- und Kreissaal nur wünschen kann: Der Teich mit eigener Quelle unter den Bäumen hat ein natürliches Tränkebecken und wird im restlichen Bereich von unseren Kühen als Kneipkurort genutzt.

Außerdem gibt es eine Mergelkuhle, die rundherum von Bäumen bewachsen ist und so einen natürlichen Schutz gegen Wind und Sonne bietet. Dorthin ziehen sich die meisten Kühe zum Abkalben zurück. Besonders in den letzten beiden heißen Sommern, war diese Weide mit Wald der beste Abkalbestall, denn nirgendwo sonst ist es auch bei über 30 Grad noch angenehm kühl.
Nach der Geburt lassen wir Mutter und Kind noch solange auf der Weide, bis das Kalb selbstständig steht und seine ersten Mahlzeiten eingenommen hat. Dadurch baut sich die erste feste Bindung auf.

Wenn Kuh und Kalb fit genug sind, holen wir sie dann meistens zu Fuß auf den Hof. Das Kalb folgt dabei der Mutter oder umgekehrt. Haben wir es mit einem eher schwachen Kalb zu tun, hilft auch schon mal die Schubkarre oder die Radladerschaufel für den Kälbchentransport aus. Ist die Bindung erst aufgebaut, folgt die Mutter ihrem Kind überallhin. Da wir dabei eine Straße überqueren müssen, haben wir keinen direkten Zugang zum Stall und es ist doch jedesmal ein kleines Abenteuer besonders dann, wenn junge Rinder das erste Mal gekalbt haben und den Ablauf noch nicht kennen. Aber ihr Vertrauen in uns und ihr Mutterinstinkt erstaunen uns dabei jedesmal aufs Neue.

Da bei uns das ganze Jahr über Kühe kalben, haben wir auch im Winter Geburten. Wie auch im Sommer, bekommen die Kühe Mutterschutzurlaub. Diesmal aber in einem großzügigen Strohstall mit Auslauf und Draußenfuttertisch. Dort bleiben sie bis sie gekalbt haben. Dadurch, dass wir die Gruppen nicht zu groß werden lassen und auf ein friedliches Miteinander der Tiere achten, gibt es keine Probleme damit, dass die Kühe in der Gruppe gebären. Im Gegenteil, der Schutz der Herde und die Fürsorge der Kameradinnen wird eher dankend angenommen, als störend empfunden. Ausnahmen bestätigen aber wie immer die Regel. Da greifen wir dann ein in dem wir diese Kühe separat unterbringen.

Das Sozialverhalten der Herde zu beobachten ist sowieso ein sehr spannendes und interessantes Thema! Ganz besonders, wenn ein Kalb geboren wird, ist es jedesmal ein aufregendes Ereignis, an dem alle interessiert sind. Kuh und Kalb werden regelrecht vom Rest der Gruppe beschützt, solange die Kuh selbst mit der Geburt beschäftigt ist. War die Geburt schwer und die Kuh ist danach erstmal erschöpft oder mit sich selbst beschäftigt und nicht in der Lage sich sofort um ihr Neugeborenes zu kümmern, dann übernehmen das immer ein oder zwei andere Kühe im Stall.

Auch für die Nachbarskinder ist eine Geburt immer ein spannendes Ereignis. Im Stall neben den Trockenstehern sind unsere Absetzer untergebracht, also die Kälber oder eher schon jungen Rinder, die dann doch irgendwann endgültig von der Mutter abgesetzt wurden. Ihre jüngeren Geschwister und Halbgeschwister werden jedesmal liebevoll begrüßt und auch umsorgt. Es passiert nicht selten, dass ein Neugeborenes sich in den Nachbarstall zu den Älteren durch die Abtrennung verirrt und dann zwischen den Brummern liegt. Dabei ist noch nie etwas passiert. Die Großen sind äußerst rücksichtsvoll mit den Kleinen.

Meistens kalben unsere Kühe alleine. Wir legen viel Wert darauf, dass alle Vorgänge so natürlich wie möglich ablaufen. Trotzdem kommt es auch mal vor, dass wir helfen müssen. Unser Deckbulle Natus ist ein Kandidat, der bei all seinen hervorragenden Attributen, leider recht große Köpfe bei den Bullenkälbern vererbt und da kann es schon vorkommen, dass in Kombination mit der ein oder anderen Kuh, unser Eingreifen notwendig wird. Mittlerweile wissen wir, welche Kühe mit ihm klarkommen und welche damit überfordert sind, so dass wir steuern können, ob Natus oder unser kleinerer Bulle Erwin für Nachwuchs sorgen darf, der sich ‚Leichtkalbigkeit‘ als vererbbares Gut definitiv auf die Fahne schreiben kann.
Die ersten drei Wochen

Sind Kuh und Kalb nach der Geburt fit genug, ziehen sie zusammen in unser Mutter-Kind-Haus um. Dort gibt es einen Bereich für die Allerkleinsten in dem drei bis vier Kühe mit ihren Kälbern Platz und Ruhe haben. Dort bleiben sie die ersten drei bis vier Wochen Tag und Nacht zusammen. Nur morgens und abends zur Melkzeit, holen wir die Mütter in den Melkstand, um sie zu melken. In diesen ersten Wochen haben sie deutlich mehr Milch, als das Kalb benötigt. Das Kalb trinkt anfangs etwa vier bis sechs Liter und steigert dann seinen Bedarf, bis es mit vier Wochen schon gut 10 Liter am Tag trinkt. Wir merken es daran, dass das Euter der Mutter besonders abends nicht mehr allzu viel Milch hergibt.

In den ersten Wochen sind Mutter und Kind fast unzertrennlich und stark aufeinander fixiert. Jede längere Trennung bringt die Kuh in große Aufregung und verunsichert das Kalb. Am Anfang und bei einigen Kühen auch jedesmal aufs Neue, ist der erste Gang in den Melkstand schon mit einiger Überredungskunst verbunden. Aber sie begreifen sehr schnell, dass es immer wieder zum Kalb zurück geht. Die Kälber interessieren sich in den ersten Wochen zwar schon für ihre Halbgeschwister und nutzen die sturmfreie Bude während der Arbeitszeit der Mütter auch schon im Alter von ein paar Tagen für die ersten Toberunden, aber die Mutter steht an erster Stelle und sobald sie zurück ist, wird erstmal Trost getrunken und Nähe getankt.

Sucht ein Kalb nach dem Melken nicht seine Mutter auf, ist es für uns schon ein erstes Anzeichen, dass es nicht ganz fit sein könnte. In diesen ersten Wochen beobachten wir die Kälber ganz genau. Trinken sie regelmäßig, sind die Köpfe und Ohren oben, reagieren sie, wenn wir in den Stall kommen, nehmen sie gleichmäßig zu? Manch eins füttern wir auch mit dem Nuckeleimer zu, bis es ganz sicher bei der Mutter das Trinken begriffen hat. Sobald Weidegang möglich ist, dürfen auch die Kleinsten mit ihren Müttern mit nach draußen. Oft dauert es ein paar Tage, bis sie sich trauen hinaus zu gehen und die Überredungskünste ihrer Mütter sind wirklich herrlich mit anzusehen. Umso stolzer sind sie, wenn ihr Kalb dann endlich mitläuft.
Im Alter von drei bis zwölf Wochen

Mit etwa drei bis vier Wochen sind die Kälber keine Neugeborenen mehr. Sie fangen an, sich mit den Gleichaltrigen zusammen zu tun und schließen sich den Kindergartengruppen an. Man fängt an, zu den „Großen“ gehören zu wollen. Sie wirken nun schon stabil und auf die Mutter kann dann etwas länger verzichtet werden. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir sie mit der Mutter zusammen in die Gruppe der 4-12 Wochen alten Kälber integrieren. Sie saufen nun schon gut 10 Liter Milch am Tag und steigern ihren Bedarf noch auf 15 Liter in den nächsten 8 Wochen. In dieser Gruppe wird nun auch nicht mehr im Elternbett geschlafen, sondern der nächtliche Umzug ins Kinderzimmer steht an.

Abends vor dem Melken trennen wir nun die Kälber ins angrenzende Kinderzimmer. Dort verbringen sie gemeinsam die Nacht, haben Wasser und Heu zur Verfügung und können die Mütter nebenan sehen und auch durch das Tor berühren. Den Kälbern macht diese Trennung in dem Alter von Anfang an nichts aus. Sie fühlen sich zwischen ihren Geschwistern sicher und brauchen keine Nachtmahlzeiten mehr. Die Kühe rufen in der ersten getrennten Nacht manchmal nach ihrem Kalb, wenn das Euter voll ist, und dann lassen wir es auch noch mal um elf oder zwölf Uhr für den Rest der Nacht dabei. In der nächsten Nacht ist dann aber in den allermeisten Fällen schon Ruhe. Kühe gewöhnen sich unglaublich schnell an einen neuen Rhythmus, wenn er nicht zu häufig wechselt.

Am Morgen melken wir die Kühe. Danach öffnen wir dann das Tor zum Kinderzimmer. Mit einem Kälberschlupf können die Kälber es den ganzen Tag über aufsuchen, was sie auch immer wieder tun. Die Kälber holen sich die verbleibende Milch ihrer Mütter und Tanten ab und toben dann durch den Stall, während die Mütter ihr Getreideschrot bekommen. Danach kehrt Ruhe ein. Kühe und Kälber wissen, dass sie nun den ganzen Tag zusammen verbringen, dadurch sind sie entspannt und zufrieden. Die Zeit reicht aus, damit die Kälber satt werden und der Sozialkontakt nicht zu kurz kommt.

Im Sommer geht es dann für alle zusammen nach dem Melken auf die Weide. Während sich die Jüngeren noch stark an ihrer Mutter orientieren, sind die Älteren meistens in Gruppen unterwegs. Es wird gerannt, gespielt, alles unter die Lupe genommen und sich nach Herzenslust ausgetobt. Die Bewegungsfreude schon der kleinsten Kälber ist unschlagbar. Da hat manch eine überbesorgte Mutter schon ihre liebe Müh hinterher zu kommen.

Irgendwann übernimmt es dann meistens eine Kuh, den Kindergarten im Auge zu behalten, während sich die anderen Kühe dem Fressen widmen. Auch Mittagsruhe wird oft von den Kälbern in gesonderten Gruppen abgehalten, bei der sich dann eine Kuh zur Aufsicht dazu stellt. Es gibt auch Schichtwechsel zu beobachten, dann geht die „Nanny“ in den Stall zurück und eine andere übernimmt ihren Job.
Ab dem 3. Monat b

Im Alter von ca zwölf Wochen fangen wir an die Kälber abzusetzen. Wenn drei bis vier Jungs oder Mädchen das Alter erreicht haben, werden sie als Gruppe abgesetzt. Zuerst lassen wir sie im Kälberzimmer, bis sie sich daran gewöhnt haben, dass sie nicht mehr zur Mutter dürfen. Nach ein paar Tagen bringen wir die Jungs dann auf unseren Pachtbetrieb ins Männerkloster, wo sie zum Eingewöhnen erst separat einen Stallbereich für sich haben und dann in die Bullenherde integriert werden. Die Mädchen bleiben auf dem Hof und ziehen in die JungrinderWG um. Im Sommer kommen dann alle auf die Weide.
Vor und Nachteile der muttergebundenen Aufzucht
Ich betone immer wieder: Muttergebundene Kälberaufzucht ist viel mehr als nur eine natürliche Milchbar. Die Besonderheit ist nicht alleine, dass die Kälber keinen Nuckeleimer bekommen, es ist der Sozialkontakt zwischen Mutter und Kind im Herdenverband. Deshalb ist für uns jede andere Art der Kälberaufzucht und sei es an einer Amme, ein unnatürlicher Kompromiss. Ebenso sind bei einer zu kurz bemessenen gemeinsamen Zeit in den ersten Wochen und Monaten, die positiven Auswirkungen nicht möglich.
Vorteile
Urvertrauen

Man merkt eigentlich erst, was ein Iglukalb nicht hat, wenn man es anders erlebt. Es fehlt ihm nämlich nicht offensichtlich etwas. Aber das Urvertrauen ist sicherlich der wichtigste und schönste Aspekt der gemeinsamen Aufzucht. Es kommt aber nur dann voll zur Entfaltung, wenn ein Kalb tatsächlich im Schutz seiner leiblichen Mutter groß werden darf. Keine Amme, kein Herdenverband allein kann es erhalten. Wir merken es am Unterschied zwischen Waisenkindern und den Kälbern, die wirklich bis zum Absetzen an der Seite ihrer Mutter sind. Es ist der Schutz und die Sicherheit, die einem Kind nur die Liebe und Fürsorge einer Mutter geben kann. Sie machen keine Negativerfahrung (dass sie auf sich allein gestellt sein könnten oder dass ihnen irgendetwas passieren könnte, wenn sie sich tiefenentspannt in eine Ecke legen, um zu schlafen). Und in dieser Sicherheit entwickelt sich ein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass nur eine gute Kinderstube hervorbringen kann!
Sozialkompetenz

Durch das Aufwachsen im Herdenverband lernen die Kälber von Anfang an die Strukturen und Hierachien einer Herde kennen. Natürlich lernen auch Iglukälber später, wenn sie in Gruppen und noch später in eine Milchviehherde integriert werden, die Regeln kennen, aber sie tun sich deutlich schwerer und müssen es oft auf die „harte“ Tour lernen. Unsere Kälber saugen das korrekte, respektvolle Verhalten gegenüber den Älteren schon mit der Muttermilch auf. Später, wenn sie als Milchkuh in die Herde zurückkehren, sind sie deutlich umgänglicher, aber auch selbstbewusster, als wir es von früher her kennen. Sie haben in ihrem Leben alles schon kennengelernt, was sie als Milchkuh kennen müssen.
Vorbildfunktion

Die Kälber lernen von den Kühen in dem sie ihnen alles nachmachen. Schon im Alter von ein paar Tagen, gehen sie mit ans Futter oder probieren im Sommer auf der Weide das Gras aus. Auch das Interesse am Getreideschrot, auf das ihre Mütter so närrisch sind, wird getestet. Das Ganze jedoch ohne Druck und Lockmittel, wie es bei der Igluhaltung forciert wird, um die Pansenentwicklung voran zu treiben. Im Alter von sechs bis acht Wochen steigt das Interesse an Kraftfutter auf natürliche Art und Weise und wenn wir dann die Milch reduzieren, können wir problemlos den Energiebedarf durch ihre Vorliebe für Getreide kompensieren.
Umgang

Durch das nächtliche Trennen und den Stallwechsel im Alter von drei Monaten, lernen sie von Anfang an sich von uns Menschen täglich treiben zu lassen. Sie lernen unterschiedliche Untergründe kennen, durch Tore zu gehen und Stufen zu überwinden. Das ist keine Selbstverständlichkeit! Viele Kühe verlassen freiwillig ihren Stall nicht, wenn sie es in jungen Jahren nicht gelernt haben und neue Umgebungen sind dann ein riesiges Problem. Unsere Rinder gehen problemlos durch jede unbekannte Tür in jeden unbekannten Stall, der Melkstand ist kein Drama und selbst auf den Viehwagen mit steiler Rampe stiegen sie ein und aus. Sie kennen und vertrauen uns, dadurch können wir ihnen bis zum Ende ein Leben ohne Stress und Angst ermöglichen.
Entwicklung

Die Kälber entwickeln sich durch die regelmäßigen kleinen Milchmengen, mit immer der richtigen Temperatur und Zusammensetzung für genau das Kalb deutlich besser als Kälber, die mit Milchpulver oder auch Vollmilch der gesamten Herde aufgezogen und meistens nur zweimal am Tag gefüttert werden. Außerdem wirkt sich die Bewegungsfreiheit positiv auf Knochen und Sehnen aus. Beides zusammen führt mit der durch Nachahmung frühzeitigen Aufnahme von Grundfutter zu einem starken Immunsystem und guten Zunahmen.
Nachteile
Der größte und eigentlich auch einzige Nachteil ist der wirtschaftliche Faktor. Ganz besonders in unserem Fall, da wir alle Kälber an der Mutter großziehen. Das sind pro Kalb ca 1500-1700 Liter Milch, die nicht verkauft werden können. Auf 70-80 Kühe gerechnet, ist das schon eine erhebliche Menge, die im Umsatz fehlt. Nur der Verkauf in Direktvermarktung von Fleisch und Milch kann diese Kosten kompensieren, da bisher keine Molkerei und keine Fleischerei den notwendigen Preis zu zahlen bereit ist.
Alle anderen Nachteile, die durch das Konzept entstehen können, sind Herausforderungen, die bereits in dem dazu gehörigen Abschnitt erläutert wurden und mit lösungsorientiertem Management in den Griff zu bekommen sind.